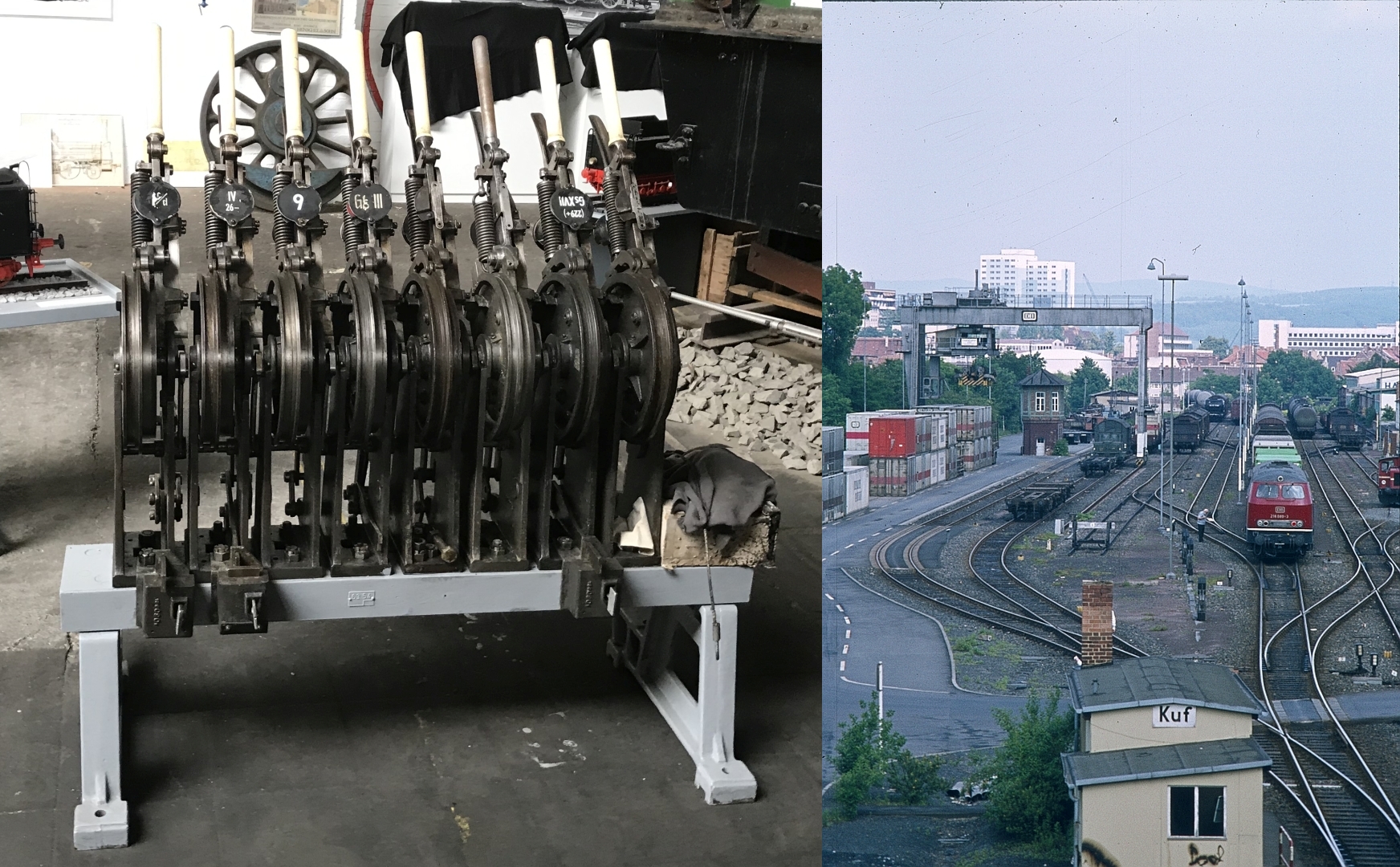Der AEG-Schalter-Fahrkartendrucker GP 630

Der AEG-Schalter-Fahrkartendrucker GP 630 (rechts) und der AEG-Kleindrucker EZT (links)
Aus der Zeit der Postkutschen stammend wurden bei den ersten Eisenbahnen in England zunächst kleine Zettel als Fahrausweise ausgestellt, so vermutlich auch in Deutschland. Dies stellte Thomas Edmondson, 1836 zum Vorsteher der Station Milton an der soeben erst eröffneten Eisenbahnstrecke von Newcastle upon Tyne nach Carlisle im Nordosten Englands ernannt, nicht zufrieden, da er sich eine bessere Kontrolle, Abrechnung und Prüfung der verkauften Fahrscheine wünschte.
Er baute eine Maschine, welche kleine Kartonstreifen im Format 13/16" x 21/4", nach unseren Maßen 30,5 mm x 57 mm, bedruckte und nummerierte sowie eine Datumspresse. Andere Stationen auf der Linie übernahmen sehr schnell dieses System und so wurde es in England bekannt. Thomas Edmondson, zum Direktor der Eisenbahngesellschaft "Manchester and Leeds Railway" ernannt, führte sein System auf allen Stationen dieser Bahn ein.